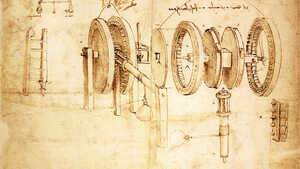Bürger sollten Zugang zu den Daten ihrer Verwaltung haben
Ihr neues Buch heißt „Responsive Cities“, man könnte das übersetzen mit „antwortende Städte“. Was meinen Sie damit?
Städte sind für die Menschen da, die in ihnen leben. Die digitale Revolution gibt den Städten die Möglichkeit, stärker mit diesen Menschen zu sprechen, für sie sichtbarer zu werden und so die Demokratie zu stärken.
Bei uns in Deutschland läuft das unter dem Schlagwort der „smarten Stadt“.
Ich verwende den Begriff nicht so gern, weil er von einigen Großunternehmen vereinnahmt wurde – IBM, Siemens, Cisco – die den Städten ihre sehr teuren IT-Systeme verkaufen wollen. Sie versprechen den Verwaltungen, dass Computer ihnen abnehmen, ihre Ressourcen sinnvoll zu managen. Es geht mir aber nicht um technische Kontrolle, sondern um technologische Unterstützung für den Austausch zwischen echten Menschen.
Sie sind für ein paar Tage in Berlin. Haben Sie das Gefühl, dass Berlin eine „responsive city“ ist?
Das weiß ich noch nicht.
Haben Sie schon versucht, hier ins Internet zu kommen?
Das ist tatsächlich nicht so leicht, es gibt kaum städtische öffentliche Netze. Dabei ist das zentral. Ohne einen stabilen Internetanschluss können sich Bürger im 21. Jahrhundert nicht politisch beteiligen.
Welcher Stadt in den USA würden Sie den Titel „responsive City“ denn zusprechen?
Insgesamt muss man sagen: Diese Bewegung ist überall auf der Welt noch am Anfang. In Amerika ist Chicago ein Vorreiter. Es gibt dort einen Bürgermeister, der verstanden hat, wie man die Macht der Daten nutzt.
Was könnte ich als Bürger in Chicago machen, das in Berlin nicht geht?
In Chicago haben Sie Zugriff auf alle Kriminalitätsdaten aus Ihrer Nachbarschaft, Sie könnten nachschauen, wofür genau in Ihrem Viertel die Stadtverwaltung wie viel Geld ausgegeben hat. Diese Daten sind alle grafisch aufbereitet.
In Chicago ist es ein Bürgermeister, der den Wandel vorantreibt. Sind es immer Einzelpersonen?
Einzelne Persönlichkeiten sind essenziell. Nehmen wir ein anderes Beispiel, Mike Flowers. Von Haus aus war er Rechtsanwalt, dann ging er in den Irak, um in Bagdad die Verbrechen der Gefolgsleute von Saddam Hussein zu untersuchen. Dort lernte er eine Gruppe junger Ökonometriker kennen, die aufgrund von Daten über vergangene Sprengfallenanschläge den sichersten Weg durch die Stadt errechnen konnten. Dieses Wissen über statistische Vorhersagetechniken brachte er mit, als er 2009 seine Stelle in der Stadtverwaltung von New York antrat. Mike sagt immer, Stadtverwaltungen hätten eine mindestens ebenso ausgeprägte Clan-Struktur wie der Irak. Jeder arbeitet gegen jeden. Aber Mike schaffte es, die verschiedenen Abteilungen zu überreden, ihre Daten mit ihm zu teilen.
Für was wollte er die Daten denn?
2011 gab es eine Serie schrecklicher Feuer in New York, Menschen starben. Mike dachte sich: Es wäre doch gut zu wissen, wo das nächste Feuer ausbrechen wird. Die Feuer waren in illegal vermieteten und überbelegten Gebäuden ausgebrochen. Über das Bürgertelefon „311“ erhält die Stadtverwaltung jedes Jahr rund 20 000 Hinweise auf illegale Vermietungen, kann aber aus Personalmangel nur acht Prozent nachgehen. Mikes Team suchte also in den Datenbanken nach Mustern, die auf illegale Vermietungen hinweisen. Sie fanden heraus, dass zwei Faktoren eine gute Vorhersage zulassen: erstens, das Gebäude war schon einmal Gegenstand einer Zwangsvollstreckung, zweitens, die Grundsteuer wurde unregelmäßig bezahlt. Wenn nun eine Beschwerde beim Bürgertelefon einging, wurde die betroffene Adresse daraufhin abgeglichen. Bei einem Treffer rückte ein Team aus Mitarbeitern der Bauverwaltung und der Feuerwehr aus.
Ist Mike Flowers heute immer noch bei der New Yorker Stadtverwaltung?
Nein, heute ist er Berater und Mentor. Aber viele der talentierten jungen Leute, die er in sein Team geholt hatte, arbeiten heute für Stadtverwaltungen im ganzen Land.
Der Abbau von Hierarchien ist wichtig, das ist Ihr Credo. Welche Rolle spielen Gesetze?
Neue Gesetze sind wichtig, zum Beispiel für „Open Data – Offene Daten“. Bürger sollten Zugang zu den Daten ihrer Verwaltung haben, alles sollte in maschinenlesbarer Form publiziert werden. Auch in den USA fehlen dafür vielerorts noch die gesetzlichen Grundlagen. Wiederum ist New York hier führend. Dort sind prinzipiell alle Daten öffentlich zugänglich.
Mit dem Ausbau der Interaktion zwischen Staat und Bürger steigen die Ansprüche an die Bürger. Sie erwähnen in Ihrem Buch ein sehr interessantes Beispiel.
New York hatte ein Problem mit der ständig überfließenden Kanalisation. Die Wasserbehörde hat beschlossen, mehr Grünflächen als Sickerflächen zu schaffen. Sie hat die Bürger auf einer Internetplattform aufgerufen, geeignete Flächen in ihrer Nachbarschaft zu melden und Gestaltungskonzepte einzureichen.
Das ist ziemlich viel verlangt. Die Leute müssen Zeit investieren, Hirnschmalz.
Natürlich hat die Stadtverwaltung die Aufgabe, Probleme zu lösen. Aber die Leute zu fragen, was sie denken, kann einen gesunden Effekt haben. Sie fühlen sich verantwortlich. Das ändert etwas zwischen Verwaltung und Bürgern.
Aber sind es nicht immer nur die digital Versierten, die sich beteiligen, die ohnehin privilegiert sind?
Gerade die städtischen Armen haben weder die Geräte noch die schnellen Internetverbindungen. Trotzdem: Nehmen wir BostonConnect, eine App, mit der man auch Schlaglöcher melden kann. Damit werden Leute erreicht, die sich vorher gar nicht beteiligt haben.
Berlin denkt darüber nach, eine Software einzukaufen, die anhand von Daten über die Muster von Einbrecherbanden gefährdete Gebiete bestimmt, die von der Polizei besonders aufmerksam beobachtet werden. Wie sind die Erfahrungen damit in den USA?
„Predictive Policing“ ist sicher Teil der datengestützten Verwaltungsmodernisierung. Aber es gibt andere Wege, die Ressourcen der Polizei besser zu nutzen. Ich untersuche gerade eine Plattform in New York, auf der Bürger Probleme in ihrer Nachbarschaft melden können. Die Nachbarn können die Hinweise bewerten und hoch- oder runter wählen. Die Polizei sagt mir, dass ihr rund 40 Prozent der Probleme vorher überhaupt nicht bekannt waren.
Gibt es keine Datenschutz-Bedenken in den USA?
Oh, doch. Man könnte zum Beispiel eine ganze Menge mit den Daten über Bildungsverläufe machen – etwa um gefährdete Jugendliche zu identifizieren. Aber die meisten Staaten schützen diese Daten vor Zweckentfremdung. Das ist in gewisser Hinsicht frustrierend.
Sie wären dafür, diese Daten zu verwenden?
Die Debatte wird von den Extremen bestimmt. Die Technikeuphoriker sagen, nehmt die Daten einfach. Die Bedenkenträger wollen nichts herausgeben. Dabei kann es Regeln geben, die einen verantwortungsvollen Umgang ermöglichen. Diesen Mittelweg müssen wir finden, wir verlieren sonst eine Menge Chancen.
Susan P. Crawford, 52, war technologiepolitische Beraterin von Barack Obama. Heute lehrt die Kolumnistin und Buchautorin („Responsive Cities“) an der Harvard Law School.