
Mit den Augen der Maschine
Links ein Selbstporträt von Rembrandt mit Samtbarett. Rechts ein dystopisches Wandgemälde einer amerikanischen Großstadt von Diego Rivera, oben Wolkenkratzer, im fiktiven Gewölbe darunter ein Heer schlafender Arbeitsloser. Verbunden werden die beiden Bilder auf nebeneinander gehängten Bildschirmen durch eine Abfolge von sechs weiteren Werken. Ein Porträt von Erasmus von Rotterdam aus dem 16. Jahrhundert, naturalistische Pastelle von Bauernhäusern in Schweden und Dänemark, ein Foto von Street Art in Melbourne.
Die Werke teilen kein Thema, keine Epoche, sie hängen nicht im gleichen Museum. Der Rembrandt hängt in der Staatlichen Gemäldegalerie in Berlin, die kommunistische Klassenkritik von Rivera in Mexiko-Stadt. Was soll das? War der Kurator betrunken?
Aber je länger man die Bilderreihe betrachtet, desto mehr bildet sich in den Leerstellen zwischen ihnen doch ein unheimliches Gefühl der Gemeinsamkeit. Mal ist die Aufteilung von zwei Bildern ähnlich, mal ähneln sich einzelne Gegenstände im Bild, mal eine unauffällige, abstrakte Form. So willkürlich, aber passend wirken diese Parallelen, dass der Rembrandt, Bild für Bild, zu Riveras Wandmalerei wird. Das Unheimliche kommt daher, dass es kein Kurator war, der die Bilder zusammensortiert hat. Jedenfalls kein menschlicher, sondern eine künstliche Intelligenz.
Die Verwandtschaft der Bilder
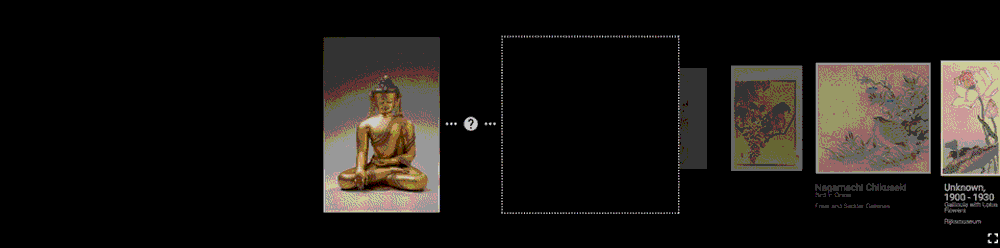
Das Modell der Maschine basiert auf Algorithmen, die normalerweise bei Google eingesetzt werden, um Bilder zu erkennen. Für das Projekt X Degrees of Separation hat der Münchner Medienkünstler Mario Klingemann diese Algorithmen im Pariser „Google Arts and Culture Lab“ so umgebaut, dass sie sich durch die Sammlungen von über 1500 Museen der Welt wühlen, auf der Suche nach dem kürzesten Weg von einem Werk zum anderen. „Es heißt, dass jeder Mensch auf der Welt jeden anderen über sieben Ecken kennt“, sagt Klingemann. Er wollte wissen, „was passiert, wenn man diese Idee mithilfe von maschinellem Lernen auf Kunstwerke überträgt.“
Klingemann interessieren die neuen Zugänge zu Bildern, die sich bei dieser Zusammenstellung ergeben. Genauso aber geht es ihm um die Frage, was für eine Art Sehen es eigentlich ist, das die Maschine lernt, wenn sie Kunst betrachtet. Wenn Menschen auf Kunst schauen, nutzen sie Kategorien. Wir können gar nicht anders, denken in Epochen und Stilrichtungen, in Techniken und Medientypen, gleichen das mit dem eigenen Geschmack ab. Das System, das Klingemann mit einem Programmierer von Google entwickelt hat, formt hingegen eigene Kategorien, nach denen es Bilder vergleicht. Es lernt Gemeinsamkeiten.
Wer bin ich?

Bei einem Art Palette, einem anderen Experiment, kann der Nutzer ein beliebiges Bild hochladen, egal ob von einem Kunstwerk oder seinem Wohnzimmer. Ein Algorithmus erkennt darin die markantesten Farben. Und zeigt anschließend die Sammlungsstücke der Welt, die ein ähnliches Farbschema aufweisen. Da stehen dann antike Vasen neben Kunstdrucken aus dem 19. Jahrhundert neben japanischen Kimonos.
Aufsehen erregte Googles Kunstprogramm, das davor wenig bekannt war, als es im Januar eine gemeinsame App mit Cyril Diagne, 32 Jahre alt und Kunstprofessor in Lausanne, veröffentlichte. Diese App gleicht über eine Gesichtserkennungssoftware das eigene Gesicht mit der Kunstsammlung ab. Innerhalb kurzer Zeit luden daraufhin 30 Millionen Menschen ihr Selfie hoch, um herauszufinden, welchem Portrait aus 3000 Jahren Kunstgeschichte sie am meisten ähneln.
Kunst organisieren

Jene scheinbar spielerischen Experimente mit der Hochkultur sind die Speerspitze des übergeordneten Kunstprogramms „Google Arts and Culture“, das bereits seit sieben Jahren arbeitet. Dabei ist es letztlich nichts weniger als Googles Versuch, die Kulturschätze dieser Welt zu digitalisieren. Denn während die Firma sich von Anfang an das Ziel gesteckt hatte, „das Wissen der Welt zu organisieren und für alle zugänglich zu machen“, war das Suchangebot in Bezug auf Kunst lange Zeit wenig revolutionär.
So stieß Amit Sood, damals Programmierer bei Google und inzwischen Leiter des Programms, bei seinen Kollegen auf offene Ohren, als er seine Idee vorstellte. Die Museen waren anfangs kritischer. Wer soll denn noch in die Ausstellung kommen, wenn man sich alles im Netz anschauen kann?
Sood meint: „In dem Moment, wo die Leiter der Institutionen verstehen, dass sie keinerlei Rechte an uns abtreten und sogar das Recht behalten, die Aufnahmen wieder aus der Online-Sammlung zu entfernen, geschieht ein Umdenken.“ Dazu kommt, dass Google den Museen das teure Abfotografieren der Sammlungen mit Spezialkamera kostenlos anbietet, die eigens dafür entwickelt wurde.
Auch das Argument der sinkenden Besucherzahlen sei irreführend. Die Erfahrung zeige, dass mehr Aufmerksamkeit für die Kunstwerke im Netz meist auch mehr Besuche zur Folge hat. Inzwischen umfasst die digitale Sammlung mehrere Millionen Bilder, nicht nur von Gemälden und archäologischen Exponaten, sondern genauso von historischen Modekollektionen und Theateraufführungen.
Shannon Darrough, Direktor für Digitale Medien am Museum of Modern Art in New York, bestätigt das. Er geht sogar noch weiter: „Man kann es mögen oder nicht. Aber wenn man heutzutage etwas nicht auf Google finden kann, ist es fast, als würde es nicht existieren.“ Darrough glaubt aber auch, dass solche Technologien neue Formen ermöglichen, Kunst zu vermitteln: „Die Grenze zwischen dem Digitalen und dem Physischen wird unausweichlich immer fließender werden.“ Die Kunstwelt sei da im Vergleich zu anderen Bereichen nur etwas langsam.
Neue Zugangsvektoren

Dem gebürtigen Inder Amid Sood, der immer wieder betont, dass sein Programm keine wirtschaftlichen Interessen verfolge, geht es aber noch um etwas ganz anderes. Er argumentiert, dass die meisten Menschen der Welt genauso wenig Anknüpfungspunkte an Museen und Kunst hätten wie er in seiner Kindheit. Zu glatt die Eingangshallen, zu elitär ihr Diskurs, zu hoch also die Schwelle. Wenn man Kultur online verfügbar mache, glaubt er, bekommen ganz neue Gruppen Zugang dazu. Durch spielerische Ansätze wie die Farbpalette oder das eigene Selfie könne man sogar noch mehr Menschen diese Welt eröffnen.
Gerade verkündete die Google-Leitung, dass sie die Mitarbeiterzahl im Pariser Firmensitz in den nächsten Monaten von 700 auf 1000 erhöhen will. Es soll dort ein neues Forschungszentrum für künstliche Intelligenz entstehen, das dritte nach Kalifornien und der Schweiz. Damit baut das Unternehmen die Vormachtstellung aus, die es bereits jetzt in dem Forschungsgebiet hat.
Vor diesem Hintergrund bekommen all diese verspielten Geschichten eine etwas andere Bedeutung. Denn während die Kunst-Experimente stets das automatische Umsortieren und Filtern, Erkennen und Kategorisieren verbindet, haftet ihnen auch immer das Unverständliche an. Es sind logische, aber im Ergbnis keine menschlichen Entscheidungen mehr. Wie genau die Maschine die Bilder vergleicht, welche Prioritäten sie dabei setzt, bleibt unverständlich. Die Maschine beschreibt zwar etwas, sie entzieht sich aber auch der Beschreibung. Sie ist nicht transparent. Und genau dieses Phänomen, könnte in den nächsten Jahrzehnten nicht nur die Kunst auf den Kopf stellen.
Die Reisekosten zu Google Arts and Culture in Paris hat Google übernommen. Einfluss auf die Berichterstattung wurde nicht genommen.






